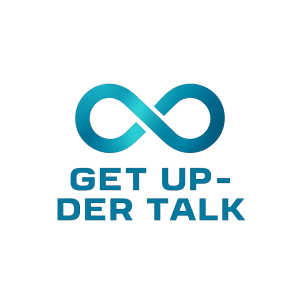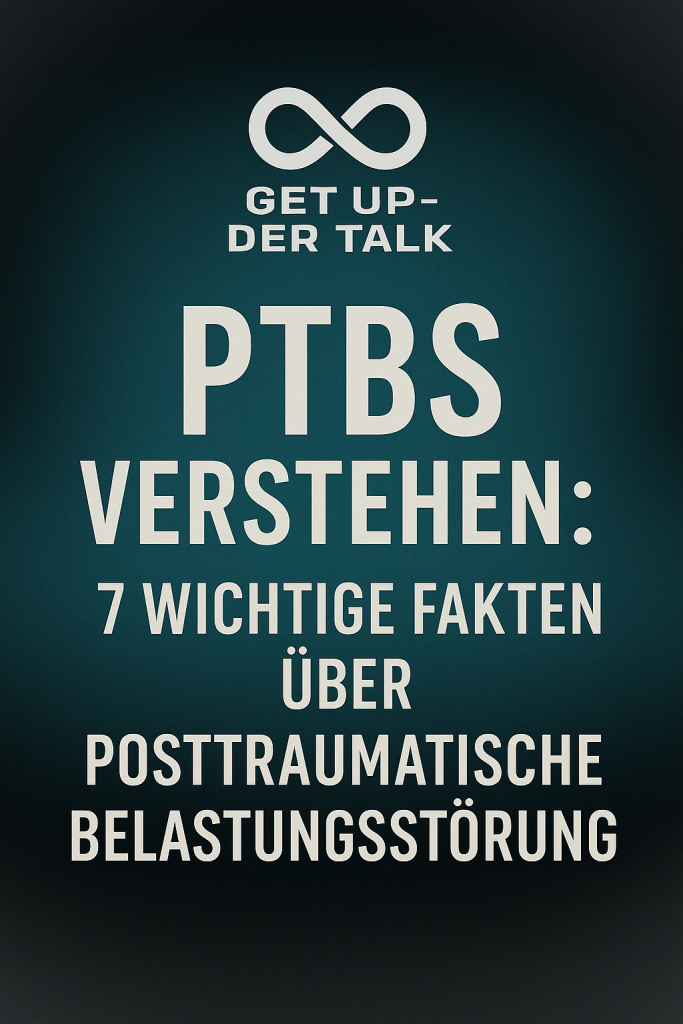Einleitung: Was du über PTBS wissen solltest (und warum das so wichtig ist)
PTBS – diese vier Buchstaben stehen für etwas, das im Leben vieler Menschen alles verändert:
Posttraumatische Belastungsstörung.
Und doch wissen viele kaum, was genau dahintersteckt.
Was ist ein Trauma überhaupt?
Wer bekommt PTBS – und wie fühlt sich das an?
Ist das „nur“ ein psychisches Problem – oder eine tiefe seelische Wunde?
Bei Get up – der Talk möchten wir mit unserer neuen Staffel genau hier ansetzen.
Denn PTBS ist kein Randthema. Es betrifft Millionen von Menschen – direkt oder indirekt.
Soldat*innen, Missbrauchsüberlebende, Unfallopfer, Menschen aus Krisengebieten oder mit gewaltvoller Kindheit.
Aber auch viele, die lange nicht einmal wissen, dass sie traumatisiert sind.
Diese Staffel will aufklären, entstigmatisieren und einen Raum schaffen – für Fakten, Erfahrungen, Stimmen.
In diesem begleitenden Beitrag erfährst du die wichtigsten Grundlagen zur PTBS:
Was sie auslöst, wie sie sich zeigt – und warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen.
Denn: Trauma ist keine Schwäche. Es ist eine Reaktion auf das Unerträgliche.
Und es verdient Gehör.
Was genau ist eine posttraumatische Belastungsstörung?
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Reaktion auf ein extrem belastendes oder lebensbedrohliches Ereignis.
Dazu zählen z. B. schwere Unfälle, Gewalt, sexueller Missbrauch, Krieg, Flucht, aber auch emotionale Vernachlässigung in der Kindheit.
Wichtig zu wissen:
Nicht jedes schlimme Erlebnis führt automatisch zu einer PTBS.
Aber: Wenn das Nervensystem überfordert ist und die Erfahrung nicht verarbeitet werden kann, „speichert“ sich das Erlebte im Körper und in der Psyche – oft über Jahre hinweg.
PTBS ist keine Schwäche, sondern eine natürliche Reaktion auf das Unnatürliche.
Typische Merkmale sind:
- Flashbacks: Das traumatische Erlebnis wird plötzlich wieder erlebt – als wäre es jetzt.
- Albträume und Schlafstörungen
- Vermeidung von Orten, Menschen oder Situationen, die an das Trauma erinnern
- Anspannung & Reizbarkeit
- Gefühlstaubheit oder Entfremdung
- Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme
PTBS beeinflusst das gesamte Erleben – oft ohne, dass Betroffene es selbst benennen können.
Manche Menschen leben jahrelang mit Symptomen, ohne zu wissen, woher sie kommen.
Deshalb ist Aufklärung so wichtig – sie schafft Sprache für das Unsagbare.
Was kann ein Trauma auslösen – und was nicht?
Viele Menschen denken bei Trauma sofort an krasse Einzelerlebnisse: Krieg, Vergewaltigung, Naturkatastrophen.
Das stimmt – aber es greift zu kurz.
Ein Trauma entsteht nicht nur durch das, was passiert – sondern auch durch das, wie wir es erleben:
Ist es überwältigend, lebensbedrohlich, hilflos machend?
Fehlt in dem Moment Schutz, Unterstützung oder Ausweg?
Dann kann selbst etwas scheinbar „Alltägliches“ traumatisch wirken:
- chronische emotionale Vernachlässigung
- psychischer Missbrauch
- Mobbing über lange Zeit
- ein demütigender medizinischer Eingriff
- der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen
Andersherum gilt:
Nicht jedes schlimme Erlebnis wird automatisch zum Trauma.
Das Nervensystem entscheidet. Und das reagiert bei jedem Menschen unterschiedlich.
Was auch wichtig ist:
Man muss sich an ein Trauma nicht bewusst erinnern, damit es wirkt.
Gerade bei frühkindlichen oder komplexen Traumata sind die Erinnerungen oft nicht kognitiv zugänglich, aber im Körper gespeichert – als Übererregung, Angst oder Erschöpfung.
Fazit:
Trauma ist subjektiv. Und es verdient immer ernst genommen zu werden – unabhängig von Ursache oder Form.
PTBS ist mehr als Flashbacks – Symptome im Alltag
Wenn Menschen an PTBS denken, haben sie oft ein bestimmtes Bild vor Augen:
Ein Mensch mit Panikattacken, Schweißausbrüchen oder Flashbacks – ausgelöst durch ein plötzliches Geräusch oder einen Geruch.
Diese Symptome gibt es tatsächlich – doch sie sind nur ein Teil der Realität.
Viele Menschen mit PTBS leben mit leiseren, dauerhaften Symptomen, die im Alltag oft gar nicht erkannt werden.
Dazu gehören z. B.:
- Schlafstörungen und chronische Erschöpfung
- innere Leere oder emotionale Taubheit
- ständige Alarmbereitschaft („Hypervigilanz“)
- das Gefühl, fremd im eigenen Körper zu sein
- Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen oder Vertrauen aufzubauen
- Rückzug aus Beziehungen, Arbeit oder sozialen Kontakten
- Konzentrations- und Gedächtnisprobleme
Manche Betroffene fühlen sich wie „abgeschnitten vom Leben“, funktional, aber innerlich leer.
Sie spüren: Irgendwas stimmt nicht mit mir, aber können es nicht benennen.
Das führt oft zu Fehldiagnosen wie Depression, Burnout oder ADHS – während das eigentliche Thema, das Trauma, unsichtbar bleibt.
Deshalb ist es so wichtig, PTBS nicht auf akute Panikmomente zu reduzieren – sondern das breite Spektrum zu sehen, in dem Trauma den Alltag beeinflusst.
Chronisch oder heilbar? Verlauf und Perspektiven
Eine der häufigsten Fragen, die Betroffene und Angehörige stellen:
Geht das wieder weg?
Die gute Nachricht:
PTBS ist behandelbar.
Aber: Der Weg ist individuell – und oft nicht linear.
Manche Menschen erleben nach einem Trauma eine akute Belastungsreaktion, die sich mit Zeit und Unterstützung von selbst reguliert.
Andere entwickeln eine chronische PTBS, die sich über Jahre zieht – mit Phasen der Stabilität und Rückschlägen.
Und wieder andere erkennen erst spät, oft nach Jahrzehnten, dass ihr Leben von einem alten Trauma geprägt ist.
Was bedeutet Heilung bei PTBS?
Nicht unbedingt, dass alles „verschwindet“.
Sondern, dass Symptome integriert werden können –
dass man sich selbst wieder spürt, sicherer im Hier und Jetzt lebt und nicht mehr vom Trauma gesteuert wird.
Therapieformen wie:
- Traumatherapie (z. B. EMDR, Somatic Experiencing, IFS)
- Verhaltenstherapie mit traumaspezifischem Fokus
- körperorientierte Verfahren
- oder Stabilisierungsarbeit
können langfristige Entlastung bringen.
Wichtig ist:
Heilung ist möglich –
nicht trotz Trauma, sondern durch das Anerkennen und Bearbeiten des Erlebten.
In deinem Tempo. Auf deine Weise.
Wer ist betroffen – und wer nicht darüber spricht
PTBS betrifft nicht „nur“ Soldat*innen oder Menschen, die extremen Gewaltsituationen ausgesetzt waren.
Sie kann jede und jeden treffen – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Lebenssituation.
Betroffen sind u. a.:
- Menschen nach sexuellen oder körperlichen Übergriffen
- Überlebende von emotionalem Missbrauch oder Vernachlässigung
- Personen mit Erfahrungen von Mobbing, Trennung oder Verlust
- Menschen, die Zeugen von Gewalt oder schweren Unfällen wurden
- Geflüchtete und Kriegsüberlebende
- Menschen aus instabilen oder suchtgeprägten Familien
Oft trifft PTBS gerade jene, die nicht darüber sprechen (können) – weil sie ihre Symptome selbst nicht einordnen oder ihnen nie vermittelt wurde, dass ihre Erlebnisse traumatisch waren.
Viele Betroffene glauben:
„So schlimm war es doch nicht.“
„Ich stelle mich nur an.“
„Andere haben Schlimmeres erlebt.“
Diese Gedanken verhindern, dass Hilfe in Anspruch genommen wird – und halten das Schweigen aufrecht.
Deshalb ist Aufklärung so wichtig:
Damit Betroffene sich wiederfinden können – und merken:
Du bist nicht schwach. Du bist nicht allein. Und du hast das Recht, darüber zu sprechen.
Wie fühlt sich Leben mit PTBS an? Stimmen von Betroffenen
PTBS ist nicht nur eine Liste von Symptomen.
Es ist ein tägliches Erleben, das oft schwer in Worte zu fassen ist.
Um besser zu verstehen, wie sich PTBS im Alltag anfühlen kann, lassen wir hier sinngemäß Betroffene sprechen:
🗣️ „Ich bin ständig müde, obwohl ich kaum schlafe. Mein Körper ist wach, mein Kopf im Alarmzustand.“
🗣️ „Ich funktioniere – aber es fühlt sich an, als würde ich mein Leben durch eine Glasscheibe beobachten.“
🗣️ „Ein Geräusch, ein Geruch, ein Satz – und plötzlich ist alles wieder da. Mein Körper reagiert, als wäre ich wieder mittendrin.“
🗣️ „Ich schäme mich, dass ich so reagiere. Ich kann’s nicht erklären. Es passiert einfach.“
🗣️ „Ich bin nicht mehr die Person, die ich mal war. Und ich wünschte, ich könnte das jemandem sagen, ohne mich verrückt zu fühlen.“
Diese Aussagen zeigen:
PTBS ist nicht immer laut, aber sie prägt, wie Menschen sich selbst, andere und die Welt erleben.
Es geht nicht um Drama – sondern um ein inneres Erleben, das oft lange unsichtbar bleibt, aber tief wirkt.
Und genau deshalb braucht es Raum, Sprache – und Menschen, die zuhören.
Hilfe ist möglich – und sie verdient kein Tabu
PTBS ist keine Einbahnstraße.
Auch wenn sich das Leben mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oft überwältigend, verwirrend oder einsam anfühlt – es gibt Wege heraus.
Psychotherapie, insbesondere traumaspezifische Verfahren, können helfen, das Erlebte schrittweise zu verarbeiten, Sicherheit zurückzugewinnen und wieder mehr Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen.
Was dabei wichtig ist:
- Heilung braucht Zeit und Geduld
- Es braucht oft mehrere Anläufe, bis die passende Hilfe gefunden wird
- Und: Es ist niemals zu spät, Unterstützung zu suchen
Neben klassischer Psychotherapie gibt es auch:
- Traumazentrierte Beratungsstellen
- Online-Hilfsangebote und Selbsthilfegruppen
- Körpertherapien wie Somatic Experiencing
- Kreative Ansätze wie Mal-, Musik- oder Schreibtherapie
Doch der wichtigste Schritt ist oft der erste:
sich selbst zu erlauben, Hilfe in Anspruch zu nehmen – ohne Scham.
PTBS darf kein Tabuthema mehr sein.
Denn Trauma ist Teil unserer gesellschaftlichen Realität –
und wer darunter leidet, hat ein Recht auf Verständnis, Raum und Unterstützung.
Fazit: Warum wir über Trauma sprechen müssen – und was unsere Podcaststaffel dazu beitragen will
PTBS ist real.
Und sie ist weit verbreiteter, als viele denken.
Ob durch Gewalt, Vernachlässigung, Verlust oder chronischen Stress – die Spuren, die ein Trauma hinterlässt, sind oft unsichtbar.
Aber sie beeinflussen Denken, Fühlen, Beziehungen und Lebensfreude.
Und genau deshalb muss Trauma raus aus der Tabuzone – hinein in die gesellschaftliche Sichtbarkeit.
Mit unserer neuen Staffel von „Get up – der Talk“ möchten wir dazu beitragen.
Wir geben Betroffenen, Fachpersonen und Stimmen aus der Mitte der Gesellschaft Raum.
Raum für Geschichten, die oft verschwiegen werden.
Raum für Verständnis, Austausch und Heilung.
Und Raum für all jene, die spüren: „Da ist etwas in mir, das endlich gesehen werden will.“
Denn Trauma ist keine Schwäche.
Es ist eine Reaktion auf das Unerträgliche.
Und darüber zu sprechen ist der erste Schritt in Richtung Veränderung.
🎧 Hör rein – ab dem 7.11.25 – auf Spotify, Apple Podcast und hier
👉 Gemeinsam schaffen wir mehr Bewusstsein, mehr Mitgefühl und mehr Bewegung in einer Welt, die oft lieber schweigt.